Einfach mal drauflos erzählen, und schon fluppt es mit dem Storytelling? Denkste! Storytelling ist wie Golfen, meint Egbert Deekeling: Der perfekte Schlag direkt aufs Grün gelingt selten. Er rät: Platz lesen, Beschwernisse erkennen und erst dann losschlagen. Ein Plädoyer für mehr inhaltliche Grundlagenarbeit.
ERSTENS: Storytelling-Hype
Ach, ist das schön! Wir haben den Stein der Weisen gefunden! Einfach das komplizierte, komplexe, unberechenbare, verworrene und widersprüchliche Geschehen unternehmerischen Handelns, das Gewirr aus Strategie und Taktik, das unverständliche Gebrabbel der Marketing-, HR- und Strategieverlautbarung auf einen schönen, knackigen Plot eindampfen und den dann dramatisch ausmalen, ja, erzählen.
Dieses Verfahren nennt sich Storytelling. Es gilt seit einiger Zeit als Allheilmittel, den Kurs von Unternehmen und Konzernen nach außen und innen zu vermitteln. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Story, das Drama, der Plot, der Aha-Effekt – all das scheint der direkte Weg zur Erkenntnis. In Zeiten von Content Management und Marketing bieten sich zudem alle Möglichkeiten facettenreicher Auf- und Zubereitung sowie schneller und zielgenauer Darreichung.
Als Reaktion auf abstrakte, technokratische Sprach- und Inhaltsangebote aus den Werkstätten der Managementberatungen, als Befreiung von den Reduktionsformaten der Strategiedarstellung und -vermittlung, besser bekannt als PowerPoint, wirkt Storytelling zudem wie eine Art agiles Modell für zeitgemäße Content-Produktion und -Distribution.
Hinzu kommt, dass Storytelling in nahezu perfekter Weise ein journalistisches Arbeitsmuster abbildet: die Suche, das Aufspüren der Pointe, der Spin, der spannende „Aufhänger“, die Geschichte vom Auf und Ab, Vor und Zurück und endlich der Sieg. Hurra! Tja, wenn das immer so schön wäre!
In einer der früheren Ausgaben des prmagazins preist der von mir sehr geschätzte Kollege Michael Inacker in seinem „Standpunkt“-Beitrag die universellen Vorzüge des Storytelling: „Beim Storytelling werden Fakten und Einschätzungen durch pointierte und neu zusammengefügte Informationen zu einer neuen Geschichte. Die Kunst besteht darin, komplizierte Vorgänge einfach zu erzählen.“ Michael Inacker erzählt dann einfach mal die Erfolgsgeschichte von der Deutschen Post und ihren E-Scootern, die wir alle kennen.
Es scheint dann aber doch am Ende etwas komplizierter zu sein, auch wenn es „verblüffende Wendungen“ gibt. Inzwischen wissen wir, dass Post-Vorstand Jürgen Gerdes rausgeschmissen wurde und – wenn man dem Storytelling im manager magazin glauben will – verzweifelt ein Käufer gesucht wird für die verlustreiche E-Scooter-Produktion.
Wem erzählen wir das denn jetzt? Was erzählen wir denn, wenn sich die frühere Story als Märchen erweist? Im schnelllebigen Geschäft des Tagesjournalismus’ mag sich so ein Lapsus schnell versenden. Die Aufmerksamkeitsdauer ist gering, jede Menge Ablenkung und Spektakuläres und – natürlich – neue Geschichten.
In der unternehmensinternen Öffentlichkeit allerdings, bei den Führungskräften und den Mitarbeitern, ist das schon etwas schwieriger. Die Glaubwürdigkeit des Top-Managements, Verständnis und Akzeptanz von unternehmerischer Strategie und Management-Handeln werden nicht durch Storys und Storytelling erreicht und noch weniger gesichert.
Es bedarf gründlicher Analyse, sorgfältiger Sprachbildung und tief durchdachter Argumentation, um vielfältige Wahrnehmungslagen, oftmals widersprüchliche Erwartungen mit einer Unternehmensstrategie und ihren Projekten und Maßnahmen verständnis- und akzeptanzfähig vorstellbar und – ja – erzählbar zu machen.
Storytelling ist, so verstanden, Anwendungskommunikation und – um Missverständnissen zu begegnen – damit selbstverständlich auch relevant. Aber die Wirksamkeit der Story und auch des noch berühmteren „Narrativs“ beruht auf intensiver Vorarbeit.
Das editorische Inhaltsangebot (Editorial Content) fußt auf einem zuvor ausgearbeiteten strategischen Inhaltsangebot (Strategic Content). Was damit gemeint ist, soll im Folgenden erläutert werden. Zunächst aber noch einmal ein genauerer Blick in die unternehmensinterne Arena.
ZWEITENS: Phänomene der Unordnung
Die sogenannte Normalität unternehmerischer Planungs- und Entwicklungsprozesse wird determiniert durch Transaktionen und Transformationen, kurz getaktet, oftmals gleichzeitig, aber selten synchronisiert: Akquisitionen, Carve-outs, Spin-offs, Disruption des Geschäftsmodells, in der Folge Integration, Desintegration, Restrukturierung, digitale Transformation. Was vor zehn Jahren noch als Ausnahmezustand deklariert wurde, ist heute in vielen Unternehmen Führungs- und Management-Alltag.
Die große Herausforderung von Konzern- und Unternehmensführung besteht darin, in unübersichtlichen Gefechtslagen ihre Agenda und ihr Handeln sinnvoll und taktisch plausibel zu begründen. Es geht ja inzwischen um die Akzeptanz einer Vielzahl sogenannter Stakeholder: Kapitalmarkt, Absatzmärkte, politische Öffentlichkeit, Medien und natürlich interne Zielgruppen, Mitbestimmung, Führungskräfte und die Mitarbeiter.
Was sich dabei als eine zwar komplexe, aber irgendwie auch lösbare Herausforderung anfühlt mit Blick auf die externen Stakeholder, stellt sich in der unternehmensinternen Meinungs- und Akzeptanzbildung als deutlich komplizierter und anstrengender dar. Hier gibt es Opfer und Gewinner, hier begrenzen Ziel- und Interessenkonflikte die Kommunikationsspielräume, hier unterminiert die Wahrnehmung von „erlittenem“ Führungsverhalten und insuffizientem Prozessmanagement die Akzeptanz und Unterstützungsbereitschaft. Hier wird zusätzliche Verwirrung gestiftet durch die tatkräftige Mitwirkung von Management- und Strategieberatungen. Empathiefreie Erklärungsangebote, technokratische Informationsprozesse und schließlich schwer verständliche Projekt- und Programm-Set-ups verstärken verlässlich den Unwillen von Betroffenen und Beteiligten.
Dazu kommen dann noch nicht harmonisierte Sprach- und Inhaltsangebote aus den Bereichen der innerbetrieblichen Bedeutungslieferanten: Die HR definiert mal eben Führungsleitlinien mit Unternehmenswerten, das Marketing erklärt die Markenwerte zur Verhaltensrichtlinie, dann gibt´s auch noch Equity Storys vonseiten der Investor Relations, nicht zu vergessen: Compliance und – als sei das nicht genug – oftmals widersprüchliche oder explizit konkurrierende Verlautbarungen der bereichsfürstlichen Verantwortungsträger in Konzerngesellschaft und Markteinheiten. Das nennt man dann Kakofonie.
Also: Richtig was los im Konzern, und jetzt packen wir das mal in ein großes Narrativ und eine knackige Story oder in den Worten von Michael Inacker: in eine „große und relevante Geschichte [...], die idealerweise [...] eine Agenda setzt“. Wie sagte Karl Valentin? „Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit!“ Es ist nun vielleicht mal interessant zu lesen, was das für Arbeiten sind, bevor wir überhaupt „storyfähig“ werden.
Drittens: Strategic Content schafft Ordnung und Verständlichkeit
„Storyfähig werden“ heißt dabei nichts anderes, als überhaupt erst einmal verstehbar zu sein. Verständnis vermittelt sich nicht von selbst. Dazu braucht es vielmehr eine inhaltliche Grundlagenarbeit, die im Wesentlichen vier Arbeitsfelder umfasst.
a) Analytische Arbeiten: Wahrnehmungslagen verstehen
Wer Geschichten über das Unternehmen erzählen will, muss die Geschichten kennen, die im Unternehmen selbst erzählt werden. Geschichten über Führungspersonen und ihr Auftreten. Geschichten über groß angekündigte Strategien und ihre Erfolge, aber auch über ihr Scheitern. Geschichten über Gewinner und Verlierer von Veränderungen – gefühlte wie tatsächliche. Geschichten über Erwartungen, Ängste und Hoffnungen.
Alle diese Geschichten spiegeln Wahrnehmungslagen und Befindlichkeiten im Unternehmen wider. Fatal, sie nicht zu kennen und nicht zu wissen, was sie für die eigene Geschichte bedeuten. Ihre genaue Analyse schafft erst die Grundlage für eine Argumentation und Sprache, die auf die Unternehmensrealität zielen und damit Authentizität und Glaubwürdigkeit ermöglichen.
b) Definitorische Arbeiten: Bullshit-Bingo übersetzen
Jeder neue Management-Hype produziert eine neue Runde im Bullshit-Bingo. Aktuelle Top-Plätze (oder schon nicht mehr?) nehmen Agiliät, Kundenzentrierung, Customer Journey, Kundenerlebnis und andere Begriffe rund um die digitale Transformation ein. Aber auch allgemeine, technokratisch geprägte Konzeptplattitüden wie Schnittstellenmanagement oder Potenzialhebung bleiben höchst erklärungsbedürftig.
Solche Begriffsmonster unreflektiert zu verwenden, schafft Unverständnis und Gleichgültigkeit statt Interesse und Identifikation. Was meint das eigentlich im jeweiligen Unternehmenskontext? Und was heißt das ganz konkret? Das muss aus dem abstrakten Management-Diskurs übersetzt und genau beschrieben werden. Und zwar in einer Sprache, die klarmacht, was sich dabei verändert und was die alte Welt von der neuen unterscheidet. Am Ende muss ein Set von Schlüsselbegriffen mit Erläuterungen stehen, die die Substanz der Strategie auf den Punkt bringen.
c) Ordnungsarbeiten: „Big Picture“ und Kontext herausarbeiten
Jeder Strategie- und Transformationsprozess produziert Gigabytes an Charts, Präsentationen, Excel-Listen. An Inhalten mangelt es nicht. Die müssen geordnet und entsprechend ihrer Bedeutung gewichtet sein, um ein Big Picture des Strategie- oder Transformationsprozesses zu zeichnen. Auch das ergibt sich nicht einfach von selbst.
Mehr noch: Eine Überfülle an Inhalten bedeutet noch lange nicht, dass alle Inhalte vorhanden sind. Geht es um Projekte, sind die oft bis ins letzte Detail beschrieben. Da wäre weniger mehr. Dafür mangelt es oft an der Herleitung der Notwendigkeit – Inhalte sind hier eher Mangelware. Ordnungsarbeit bedeutet also immer auch nachgelieferte Kontextualisierung der Strategie und Transformation. Nur so lassen sich leicht nachvollziehbare und immer wiederkehrende Argumentationsmuster bestimmen. Das ist für Plausibilität und Verständnis unverzichtbar.
d) Zielbild-Arbeiten: Sinnhaftigkeit verdeutlichen
Eine weitere, gern übersehene Leerstelle: das Zielbild. Oft auch verwechselt mit der Zielvereinbarung des Managements. Eine betriebswirtschaftliche Kennzahl mag Sinn für die persönliche Agenda eines Top-Managers stiften – für die Sinnstiftung im Unternehmen reicht das bei Weitem nicht aus. Hier geht es um ganz anderes. Es braucht einen prägnant formulierten Zielsatz, der den künftigen Zustand des Unternehmens in einem definierten, handlungsrelevanten Zeitraum beschreibt. „Vision“ ist dafür ein anderer gängiger Begriff. Nur das gibt der Strategie ihre eigentliche Relevanz und Sinnhaftigkeit. Die Erarbeitung eines Zielbilds ist daher eine der wichtigsten Aufgaben bei der Entwicklung von Strategic Content.
Fazit: Nicht zu früh losschlagen!
Die Story-„Macher“ und die Story-„Teller“ suchen gern – wie man im Golfsport sagt – die „Tiger Line“, den genialen Schlag über Hindernisse und Unübersichtlichkeiten hinweg direkt aufs Grün. Aber, um im Bild zu bleiben: Das gelingt höchst selten, meist geht der Ball verloren und wird auch nicht mehr gefunden. Besser systematisch und sorgfältig vorgehen, auf dem Fairway heißt das: Platz lesen, Beschwernisse erkennen und erst dann losschlagen. In der Content-Arbeit gilt die einfache Regel: Erst erzählen, wenn das Terrain erkannt und verstanden ist, um dann Begriffe, Argumente, Motive und Bilder sinnvoll einzusetzen in ein dann auch wirklich wirksames Narrativ!
Der Beitrag von Egbert Deekeling wurde veröffentlicht im prmagazin 08/2018 in der Rubrik „Standpunkt – Branchenprofis zur Zukunft der Kommunikation“, Sie können das pdf des Beitrags hier herunterladen.
Foto: iStock.com/peterschreiber.media

 LinkedIn
LinkedIn
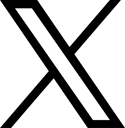 Twitter / X
Twitter / X
