Von Julika Benz
Restrukturierungen fordern Unternehmen in vielfältiger Weise heraus, insbesondere der internen Kommunikation kommt eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu. Diese muss Ängste aufnehmen, eine verständliche Zukunftsvision bieten und zur aktiven Teilnahme ermutigen, mit dem Ziel, die Belegschaft trotz bestehender Unsicherheiten und Ängste vor einem Personalabbau zu motivieren und zu halten.
Restrukturierungen als komplexe Kommunikationsaufgabe
Kommunikativ ist in der Restrukturierung eine Mammutaufgabe. Die Vielzahl der internen und externen Stakeholder mit spezifischen Forderungen und Bedürfnissen, der enge rechtliche Rahmen und der häufig hohe Grad an Emotionalität ergeben eine komplexe Gemengelage.
Der Erfolg einer Restrukturierung hängt wesentlich von Mitarbeitenden und Führungskräften ab. Sie müssen die Restrukturierungsmaßnahmen mittragen und gleichzeitig den Betrieb aufrechterhalten. Es gilt zudem, Talente zu fördern, damit diese die Zukunftsvision nach erfolgter Restrukturierung erfolgreich umsetzen. Wie soll das gelingen, wenn Führungskräfte und Mitarbeitende innerlich auf Distanz zu ihrem Arbeitgeber gehen, im schlimmsten Fall sogar das Unternehmen verlassen? Studien zeigen, dass ein Personalabbau von nur 1 % bereits zu einem Anstieg der freiwilligen Fluktuation um 30 % im Folgejahr führt. Ein solches Szenario gefährdet den Erfolg einer Restrukturierung.
Ein besonderes Augenmerk muss auf den jungen Mitarbeitenden liegen. Im Zweifel machen sie mit einschneidenden Maßnahmen ihre „Ersterfahrung“. Und ihre Generation steht wesentlich für die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens von morgen.
Kommunikation hilft
In der einen Restrukturierungsprozess begleitenden internen Kommunikation sollte der Fokus verstärkt auf den betroffenen Mitarbeitenden liegen – aber nicht nur jenen, deren Arbeitsplatz wegfallen soll. Es wird oftmals unterschätzt, wie stark Restrukturierungsmaßnahmen auch die Mitarbeitenden beeinflussen, die nicht unmittelbar von Veränderungen betroffen sind. Die Gründe, die das Commitment zum Arbeitgeber in solchen Fällen schmälern, sind vielfältig:
- Unsicherheit: die Mitarbeitenden fragen sich, inwieweit sie selbst und der eigene Job von Maßnahmen betroffen sind.
- Survivor-Syndrom: Wenn andere Kolleg:innen gehen müssen, führt dies zu einem schlechten Gewissen und dem Gefühl, man selbst habe den Arbeitsplatz nicht verdient.
- Zweifel am Unternehmen: Die Zukunftsfähigkeit und Attraktivität des Arbeitgebers werden infrage gestellt.
Hinzu kommt bei Führungskräften häufig:
- Überforderung: Neben Tagesgeschäft und Projektarbeit für die Restrukturierung führt die emotionale Belastung im Zuge der Begleitung des Personalabbaus oft zu extremem Druck.
Eine erfolgreiche interne Kommunikation sollte auch die Frage beantworten, wie können vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels Talente im Unternehmen gehalten werden, auch wenn dieses in eine Schieflage geraten ist oder kurz davorsteht. Drei Aspekte sollten dabei berücksichtigt werden:
Eine attraktive Zukunftsvision anbieten
Gerade aufgrund von klar definierten KPIs, die die Formel „Kosten runter – Leistung rauf“ in Maßnahmen übersetzen, wird die Restrukturierungskommunikation schnell technokratisch und fokussiert sich auf die Problembeschreibung. Die Fragen lauten aber: „Was kommt danach?“, „Was hat das ,Danach‘ für Mitarbeitende zu bieten?“ und „Wo liegen langfristige Vorteile für die Mitarbeitenden?“ Ein Buzzword-Bingo sollte dabei vermieden werden, denn „Flexibilität“, „Wettbewerbsfähigkeit“ und ähnliche austauschbare Floskeln machen Beschäftigte misstrauisch. Vielmehr sind konkrete Vorteile gefragt: Offshoring bringt vielleicht internationale Karriereperspektiven; Reorganisation hilft, Silos zu überwinden; einhergehende Digitalisierung bringt Effizienz und Arbeitserleichterungen etc.
Die „Lähmschicht“ durchdringen
Hat das Unternehmen ein glaubwürdiges, weil konkretes und floskelfreies Zukunftsbild formuliert, geht es darum, die Führungskräfte aller Ebenen individuell zu befähigen. Individuell meint hier: auf keinen Fall auf die Selbstorganisation der Kaskade verlassen. Spürt die erste Führungsebene oftmals noch den Puls des strategischen Manövers und ist deshalb schnell sprechfähig, tun sich darunterliegende Ebenen schwer mit der Vermittlung von Botschaften. Das Ergebnis ist die berühmte „Lähmschicht“, das mittlere und untere Management, das nicht genug Informationen erhält und so Veränderungsprozesse verlangsamt oder im schlimmsten Fall zum Scheitern bringt. Aber genau auf diese „Frontlinien“-Führungskräfte kommt es besonders an. Sie sind der erste Kontakt bei Fragen, Sorgen und Ängsten. Sie wissen, wie der Laden läuft und kennen „die Leichen im Keller“. Kommunikations- und Befähigungsmaßnahmen sollten daher passgenau auf diese Führungsebene ausgerichtet sein. Dazu gehören ein Informationsvorsprung und eine inhaltliche und emotionale Vorbereitung auf Gespräche und Fragen. Insbesondere die Sensibilisierung für eine mögliche Abwanderung von Talenten sollte erfolgen. Wenn Führungskräfte sichtbar und zugänglich sind, dann können sie auch glaubwürdig für die Zukunft des Unternehmens stehen und Sorgen und Wünsche adressieren. Diese Befähigung kostet Zeit und Geld. Ein Grund mehr, entsprechende Maßnahmen nicht erst bei der Implementierung der Zielstruktur anzudenken.
Das Gefühl des Ausgeliefertseins überwinden helfen
Die Mitarbeitenden, die nach einer Restrukturierung bleiben, müssen die Arbeit fortführen – meistens in kleineren Teams und mit reduzierten Mitteln. Selten werden Versuche erfolgreich sein, notwendige Organisations- und Prozessanpassungen rein top-down durchzusetzen. Viel lohnender ist es, Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben, sich an der Gestaltung neuer Abläufe und Strukturen aktiv zu beteiligen. Auf diese Weise kann dem Gefühl, der Restrukturierung hilflos ausgeliefert zu sein, entgegengewirkt werden. Die Kommunikation sollte in diesem Fall dazu anfordern, sich mit Fragen, die die Restrukturierung aufwirft, auseinanderzusetzen. Und sie sollte dazu entsprechende Formate anbieten. Der Umfang der Beteiligung ist konkret abzuwägen und kann zum Beispiel durch die Einbindung von Beschäftigten in der Analysephase, bei der Maßnahmenumsetzung oder beim Design des Target Operating Models erreicht werden.
Die Berücksichtigung von Ängsten und Bedürfnissen der Mitarbeitenden, die die Restrukturierung mittragen und erfolgreich umsetzen sollen, ist eine essenzielle Aufgabe der internen Kommunikation. Dabei sollte regelmäßig über die erreichten Fortschritte informiert sowie persönliche Perspektiven und Möglichkeiten zur aktiven Gestaltung und Partizipation aufgezeigt werden. Eine Vernachlässigung dieser Perspektive könnte sich selbst dann rächen, wenn die Entbehrungen und Mühen der Restrukturierung längst überwunden zu sein scheinen.
Eine frühere Version des Beitrags erschien im November 2023 in Restructuring Business, Ausgabe 04_2023, hier können Sie den Originalartikel herunterladen.
Foto: iStock.com/travenian

 LinkedIn
LinkedIn
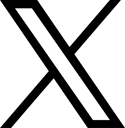 X, ehemals Twitter
X, ehemals Twitter

