Von Serkan Agci
Rezessionen sind für den Wirtschaftsstandort Deutschland nichts Neues. Auf die Finanzkrise im Jahr 2009 folgte eine Dekade des stetigen Wachstums, die mit der Corona-Pandemie endete. Mit der Bewältigung der gegenwärtigen Krise jedoch tut sich das Land so schwer wie selten. Hauptgrund hierfür: Die Schwächen des Standorts können nicht länger ignoriert werden. Um auch künftig wettbewerbsfähig zu bleiben, ist neben einer Verbesserung der standortpolitischen Bedingungen auch eine stärkere Kommunikation zwischen Unternehmen und Politik notwendig.
Letztlich gilt für Unternehmen unverändert: In einem Land, in dem die Wirtschaft so eng mit sozialen Werten verflochten ist und der gesellschaftliche Konsens einen so hohen Stellenwert genießt wie in wenigen Ländern der Welt, sind gegenüber Belegschaft, Öffentlichkeit, aber auch politischen Stakeholdern Geschick und Sensibilität gefordert.
Die Kommunikation von Unternehmen ist daher nicht einfach Nachrichtenübermittlung: Jedes Wort, jede Geste, ja selbst das Schweigen wird von Beschäftigten, Gewerkschaften, Öffentlichkeit und von politischen Stakeholdern interpretiert und kann weitreichende Folgen haben.
Das Beispiel Michelin im Saarland
Das Werk des Reifenherstellers Michelin in Homburg, einst ein florierender Knotenpunkt der industriellen Produktion im Saarland, steht exemplarisch dafür, welche Wirkung eine die öffentlichen Belange vernachlässigende Kommunikation haben kann. Als Michelin im November 2023 aus scheinbar heiterem Himmel ankündigte, das Werk zu restrukturieren und die Hälfte der 1600 Arbeitsplätzen abzubauen, entstand ein Szenario, das mehr als nur ökonomische Dimensionen berührte. Es ging um Menschen, um einen Standort, um die Zukunft einer ganzen Region. Die Ankündigung traf nicht nur die betroffenen Mitarbeiter:innen unvorbereitet, sondern auch viele politischen Entscheidungsträger:innen.
Den Stellenabbau begründete das Unternehmen vor allem mit veränderten Marktbedingungen: Neben dem verstärkten Import von Billigreifen wurden als weitere Gründe für die Restrukturierung die hohe Inflation und die steigenden Produktionskosten in Deutschland genannt.
Diese Argumentation ist nachvollziehbar, sie reicht jedoch nicht aus. Die Schwierigkeiten, mit denen Michelin zu kämpfen hatte, waren ja nicht von heute auf morgen entstanden, sondern unter anderem auch die Folge von veränderten globalen Märkten, etwa dem Vordringen asiatischer Unternehmen, die dank staatlicher Unterstützung zu deutlich günstigeren Bedingungen ihre Produkte anbieten können.
Der Schmetterlingseffekt fehlgeleiteter Kommunikation
Aus unserer langjährigen Erfahrung in der Beratung von Unternehmen bei der Vorbereitung und Umsetzung von Restrukturierungen halten wir es für essenziell, den Dialog mit Stakeholdern als strategisches Instrument frühzeitig aufzunehmen. Dies bedeutet im Fall von politischen Entscheidungsträger:innen nicht nur zu informieren, sondern sie als Partner:innen zu betrachten. Ein proaktiver, transparenter Austausch kann helfen, gemeinsame Lösungen zu finden. Er schafft Vertrauen und Verlässlichkeit. Beides ist hilfreich, wenn es darum geht, in Krisenzeiten schnell zu reagieren.
Auch das wissen wir aus unserer Tätigkeit insbesondere in Berlin: Die Politik hat ein Eigeninteresse an einem kontinuierlichen Austausch mit der Wirtschaft. Denn in der globalisierten Welt von heute gleicht eine fehlgeleitete Kommunikation dem Flügelschlag eines Schmetterlings, der einen Sturm auslösen kann. Falsche Botschaften oder unklare Absichten können Misstrauen säen und eine ganze Region in Aufruhr versetzen. Dies mindert die Attraktivität des Standorts Deutschland für internationale Investoren – aber auch für heimische Akteure, die vermehrt über eine Verlagerung ihrer Produktion ins Ausland nachdenken.
Gradmesser für die Attraktivität Deutschlands
Auch die Politik weiß: In einer globalisierten Wirtschaft, in der Entscheidungen eines einzelnen Unternehmens internationale Beachtung finden können, wird die Art und Weise, wie man mit Restrukturierungen umgeht, zum Gradmesser für die Attraktivität Deutschlands. Gerade jetzt in der Krise ist die Kommunikation zwischen Unternehmen und Politik ein entscheidender Faktor. Sie erfordert ein hohes Maß an Feingefühl, eine starke Vernetzung, Verantwortungsbewusstsein und strategisches Denken.
Wir als DAA sind seit vielen Jahren mit unserem Büro in Berlin ein erfolgreicher Brückenbauer zwischen Unternehmen und politischen Entscheidungsträger:innen. Wir führen beide Seiten zusammen, etwa in unseren Formaten „Berliner Dialog“ und „Junger Berliner Dialog", wir vermitteln Kontakte und unterstützen dabei, das gegenseitige Verständnis für den jeweils anderen zu fördern. In einer Welt, in der die Grenzen zwischen lokalen Handlungen und globalen Auswirkungen verschwimmen, macht das den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg aus.
Foto: iStock.com/bfk92

 LinkedIn
LinkedIn
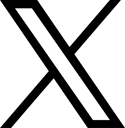 X, ehemals Twitter
X, ehemals Twitter

